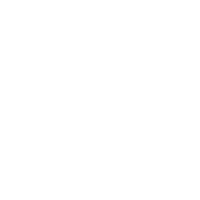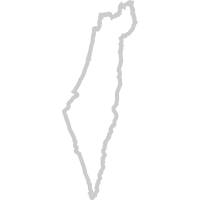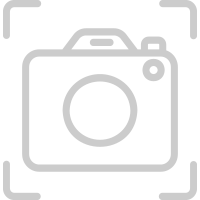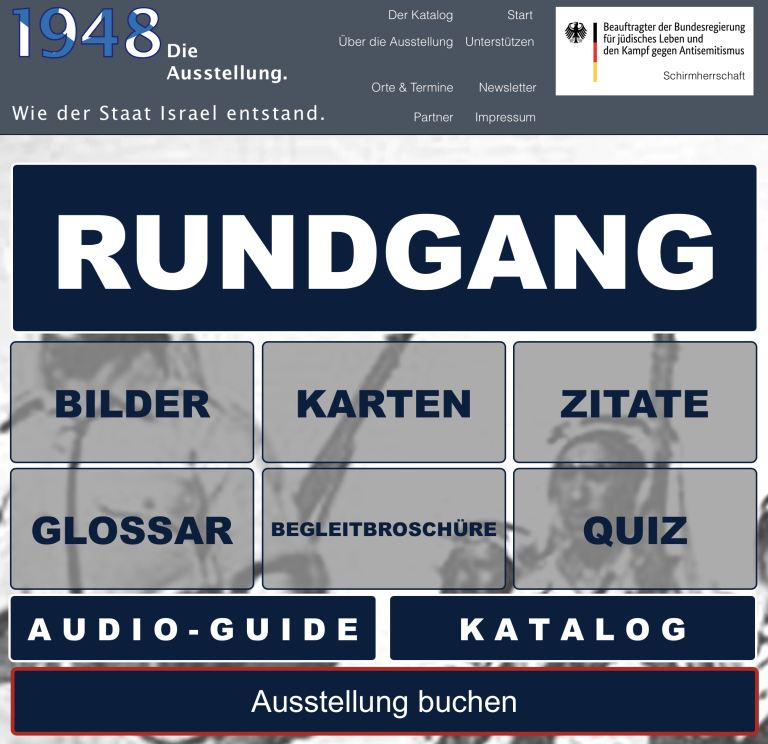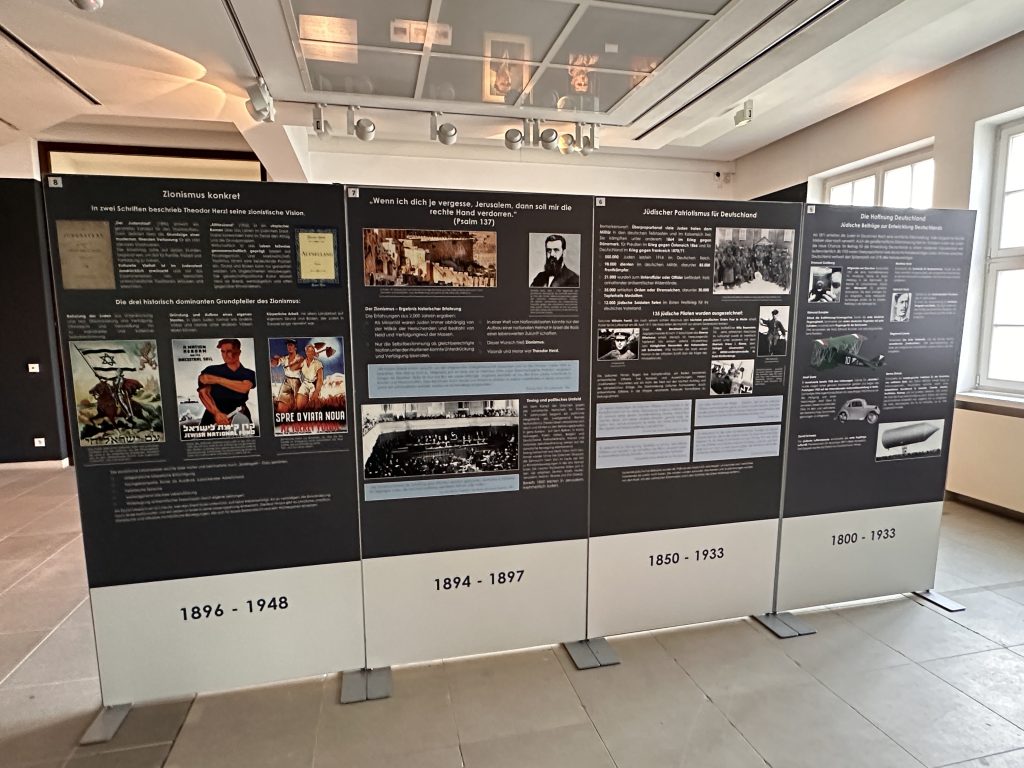1. Spendenaktion für traumatisierte Kinder in Israel
Eine große Anzahl von Kindern wurde bei den Geschehnissen des 7.Oktobers 2023 Zeuge von Massenmorden, Gewalt, Zerstörung und Entführung und haben oftmals das eigene Zuhause verloren. Durch diese Erlebnisse sind viele von ihnen traumatisiert. Wir möchten die Kinder nicht alleine lassen und ihnen Therapien ermöglichen, die ihnen helfen können, das Erlebte zu verarbeiten, damit es trotz Traumata und Verletzungen weitergeht. Yossi Regev, ein Künstler aus unserer Partnerstadt Ness Ziona, stellt Gemälde zur Verfügung, die wir hier in Solingen anbieten möchten. Diese gesamten Einnahmen werden an den JNF-KKL (Jüdischer Nationalfonds e.V. Keren Kayemeth Leisrael)
2. Wiederaufforstung nach der Wiederaufforstung – Israels Norden in Flammen
Wir unterstützen auch dieses 2. Projekt durch einen Spendenaufruf, denn das Tragische an den aktuellen Ereignissen ist, dass Millionen der Bäume, die erst kürzlich gepflanzt wurden, durch massiven Raketenbeschuss aus dem Libanon in Flammen gesetzt und zerstört wurden. Dabei sind bereits heute mehr Bäume verbrannt als im Libanonkrieg von 2006. Damit wird die Lebensgrundlage und der Sauerstofflieferant aller Menschen in der Region, egal welcher Glaubensrichtung und welcher politischen Orientierung zerstört. Die komplette Wiederaufforstung der Wälder und der Wiederaufbau zerstörter Spiel-und Picknickplätze gehört zu den wichtigen Aufgaben des JNF-KKL.